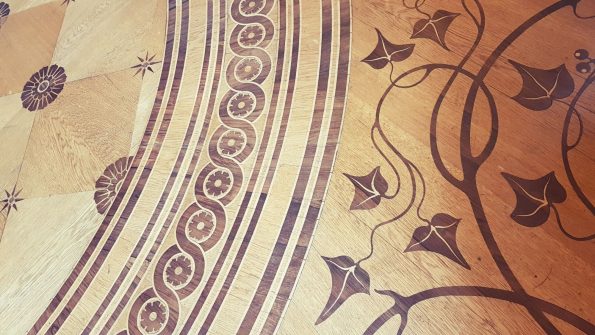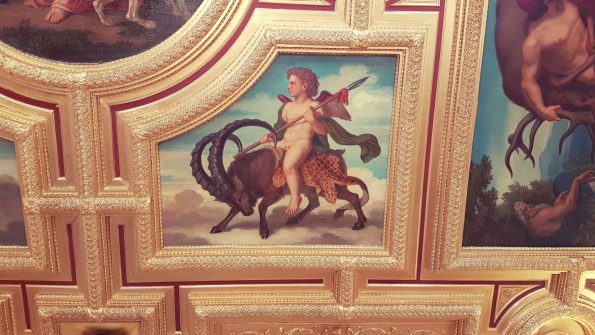Im Waldviertel beherrschen seit einigen Jahren die Borkenkäfer die Diskussionen an forstlichen Stammtischen. Deshalb greift das Ländliche Fortbildungsinstitut dieses Thema auf: Direkt von einem Waldstandort in Modsiedl (Gemeinde Raabs an der Thaya) wird der Forstexperte der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Dipl.-Ing. Karl Schuster, über Bekämpfungsmöglichkeiten des Borkenkäfers berichten. Das besondere daran: Bei diesem „Farminar“ kann man bequem vom eigenen Rechner aus zusehen und auch Fragen an den Vortragenden stellen. Themen des Seminars: Ursachen für eine derartige Kalamität, Vermehrung der Käfer, Vorbeugungs- und Abwehrmaßnahmen.
Termin und Modalitäten
Das „Farminar“ findet am Montag, dem 14. Mai 2018, von 13.30 bis 14.30 Uhr statt. Die Anmeldung ist bis 10. Mai möglich. Die Zugangsdaten und die Anleitung werden rechtzeitig per eMail zugesandt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Das besondere am Farminar
„Farminar“ ist ein Kofferwort aus „Farm“ und „Seminar“. Entstanden sind Farminare in den USA, wo sie in erster Linie zur Vernetzung der weit auseinander liegenden Höfe eingesetzt werden. Hintergrund: Welche Bäuerin und welcher Bauer kennt es nicht? So gerne würde man an Exkursionen teilnehmen und anschauen, wie andere Betriebe Herausforderungen meistern. Aber die eigene Arbeit am Betrieb lässt dies oft einfach nicht zu. Der Weiterbildungsbedarf steigt, die verfügbare Zeit nimmt hingegen ab. Beim Farminar führt eine Fachexpertin oder ein Land-/Forstwirt durch den Stall, in den Wald oder über das Feld und präsentiert interessante Arbeitspraktiken oder Gerätschaften. Diese Erläuterungen werden live übertragen und können so von jedem internetfähigen Gerät angeschaut werden. Die Anreise entfällt. Das Farminar ist eine praktische, innovative Ergänzung als Ergänzung zum persönlichen Erfahrungsaustausch.
Erfahrung mit E-Learning am LFI
Das Ländliche Fortbildungsinstitut erweitert zunehmend das Angebot innovativer, nicht ortsgebundener Weiterbildungsformate – eLearning-Kurse, Webinare und Farminare. Ich habe selber an den Webinaren „Bauernhof der Zukunft“ (online nachzuschauen) und „Datenschutz NEU – Was ist zu tun?“ (weitere Termine verfügbar!) teilgenommen. Mir hat die Strukturierung und Moderation gut gefallen – der Input der jeweiligen Experten wurde in Abschnitte gegliedert, und nach jedem Abschnitt war Zeit für Fragen und Diskussion eingeplant. Außerdem sind über das Tool Abfragen wie „aus welchem Bundesland kommen Sie“ oder „wie sehr fühlen Sie sich schon vorbereitet“ möglich, die einen interessanten Einblick in die TeilnehmerInnenstruktur geben.
Auch einen Onlinekurs habe ich schon absolviert – „Grundlagen einer professionellen Almbewirtschaftung„.