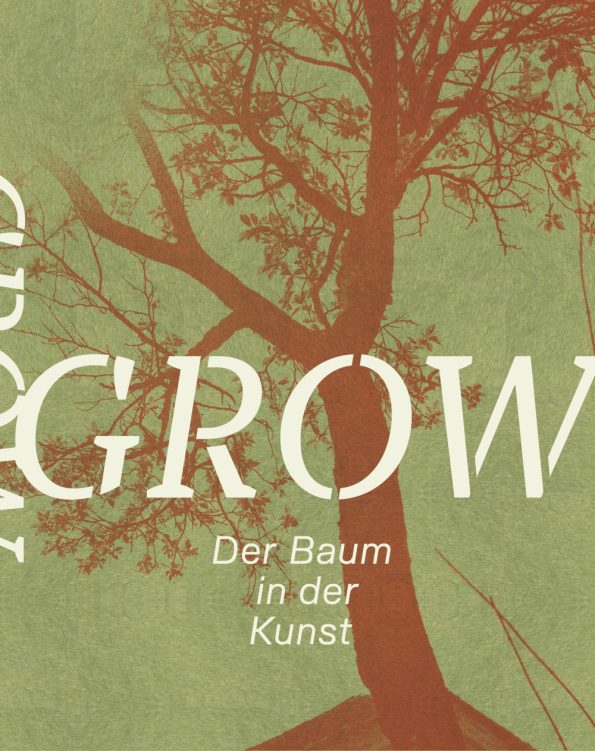Heute um 20:15 wird auf ORF2 die Folge „Zerreißprobe“ der Serie „Der Bergdoktor“ gezeigt – diesmal mit einem forstlichen Thema:
Forstwirtin Kim Sattler scheint mit Stress gut umgehen zu können. Die Scheidung von ihrem Mann ist friedlich verlaufen. Neben der Erziehung ihrer Kinder behauptet sich Kim tagtäglich erfolgreich in einem männerdominierten Beruf. Da droht ein folgenschwerer Unfall die junge Frau völlig aus der Bahn zu werfen. Ein Kollege stirbt und die Belegschaft gibt Kim die Schuld daran. Als Martin sich ihre Verwundungen ansieht, erfährt er von heftigen Muskelkrämpfen. Hat Kim die Krankheitssymptome zu lange ignoriert?
Kim Sattler wird von Isabell Polak gespielt.


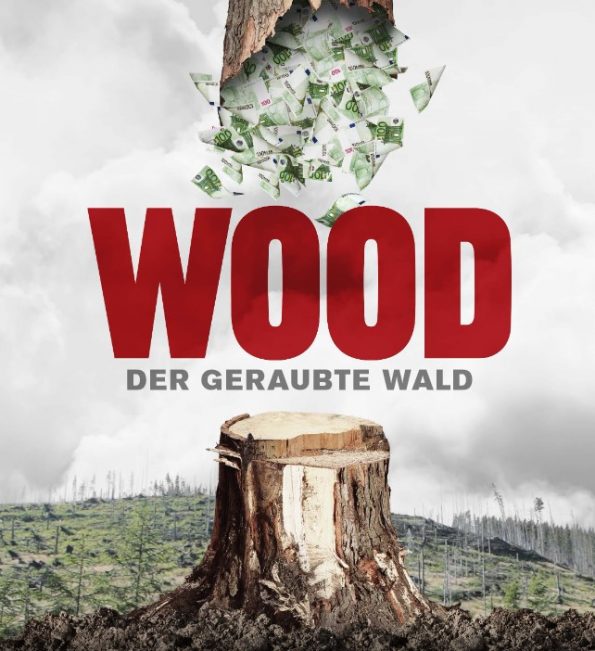
 „
„